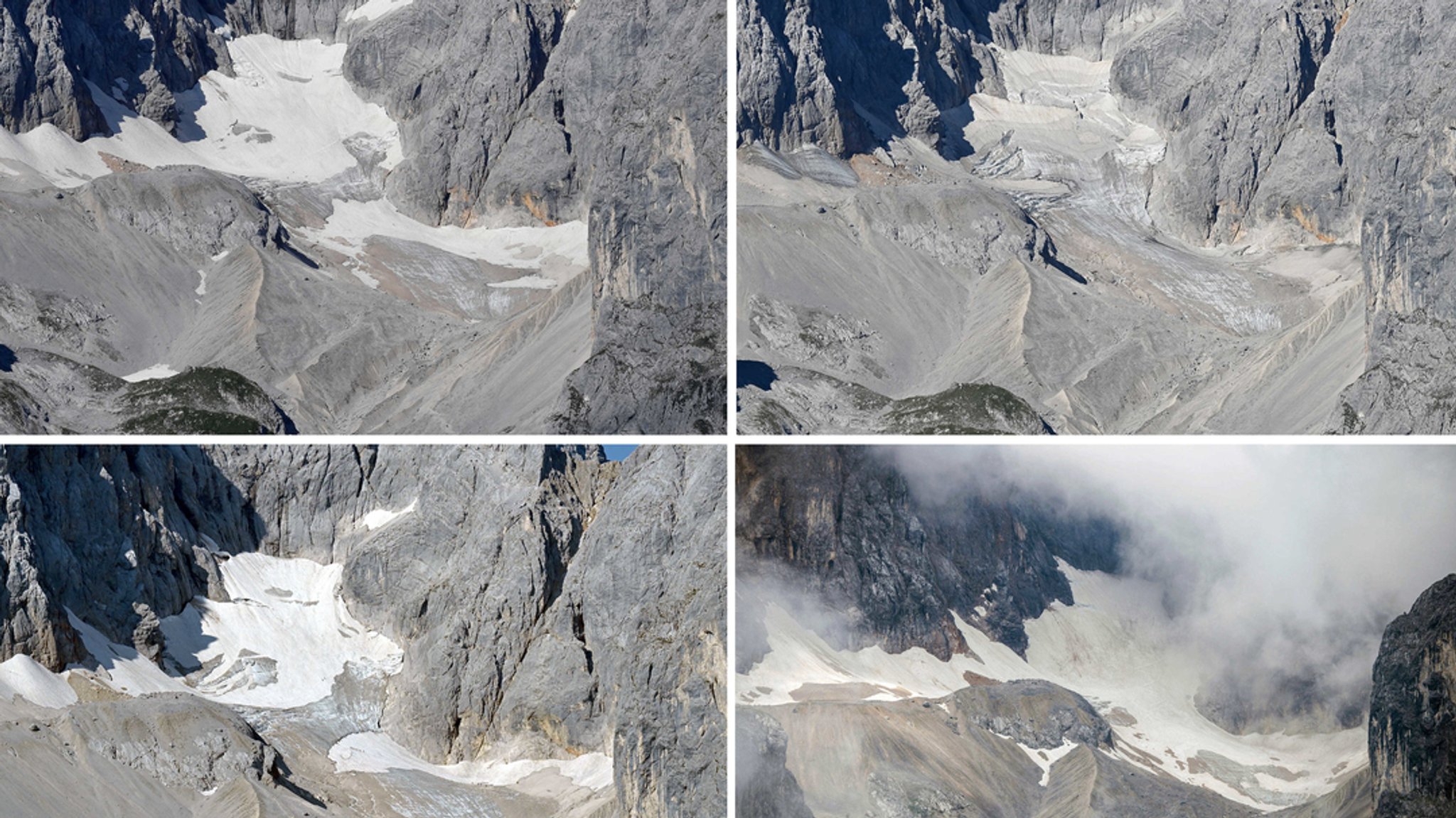Darum geht’s:
- Die Erderwärmung stellt uns vor Herausforderungen. Einige aber wollen verhindern, dass politische Maßnahmen zur Milderung und Anpassung ergriffen werden.
- Deshalb nutzen sie Falschinformationen, die gezielt Ängste und Sorgen der Menschen aufgreifen – und psychische Bedürfnisse bedienen.
- Denn wir suchen uns gedankliche Auswege – und können dabei in Fallen tappen. Wer die gängigen Fluchtwege kennt, kann sich davor schützen.
Maßnahmen gegen den Klimawandel verzögern und Menschen durch Empörung an sich binden – darauf zielt Klima-Desinformation ab. Dafür streuen Politiker oder Aktivisten falsche Behauptungen, mit denen sie Wissenschaftler, Daten oder Entscheidungen diskreditieren wollen. Das folgt klaren Mustern, die sich stets wiederholen – zum Beispiel:
- "Das Klima verändert sich nicht – oder auf ganz natürliche Weise, du musst nichts tun."
- "Die Erderwärmung betrifft uns nicht."
- "Deutschlands CO2-Ausstoß ist zu gering, zuerst sollen die anderen ran."
- "Klimaschutz-Maßnahmen werden uns nur schaden."
Die Argumente, die für diese Leugnungs-Strategien bemüht werden, sind meist Scheinargumente. Klima-Desinformation ist dennoch erfolgreich und verbreitet. Denn sie bedient zentrale psychische Bedürfnisse. Und die Akteure nutzen mit Tricks aus, dass unser Denken uns in Fallen locken kann. Ein Überblick.
1) Wir erleben kognitive Dissonanz - ein inneres Dilemma
Wichtig ist: Ein Großteil der Bevölkerung kennt die Fakten. Andreas Becker, Leiter der Klimaüberwachung beim DWD, sagte dem #Faktenfuchs: "Wenn Sie Umfragen in der Bevölkerung machen, bestehen eigentlich keine Zweifel am Klimawandel." Die Erfahrung des DWD sei auch nicht, dass es noch einen großen Disput über die Fakten des vom Menschen gemachten zusätzlichen Klimawandels gebe.
- Alle aktuellen #Faktenfuchs-Artikel finden Sie hier.
Becker sagt aber auch: Gerade wenn es um konkrete Wege gehe, um den Klimawandel zu dämpfen, gerieten einige ins Wanken. "Da geht es dann natürlich an Maßnahmen heran, die mich eventuell auch persönlich betreffen. Da empfinden wir eine kognitive Dissonanz: Einerseits ist klar, da ist ein Problem, und man müsste etwas tun. Andererseits ist da die persönliche Ebene, auf der man das vielleicht nicht möchte, weil es mich persönlich einschränken könnte."
- Zum Artikel: Klimawandel morgen: Die Folgen für meine Region
Klimaschutz kann also Sorgen bereiten, weil er auch persönliche Veränderungen mit sich bringen könnte. Auch der Anlass für Klimaschutz selbst löst Gefühle aus: Längere Trocken- und Hitzephasen – und zugleich das Risiko für Extremniederschläge und Sturzfluten: All das wird wegen des Klimawandels zunehmen, auch in Bayern. Das kann Menschen Angst machen.
"Ich glaube, dass viele Menschen tief in ihrem Inneren genau wissen, was eigentlich los ist", sagt auch Stephan Lewandowsky. Er ist Professor für Kognitionspsychologie an der University of Bristol und derzeit an der Universität Potsdam Leiter des Projekts Protecting the Democratic Information Space in Europe. "Der Durchschnittsbürger hat wahrscheinlich Angst sowohl vor dem Klimawandel als auch davor, etwas dagegen zu unternehmen", sagt Lewandowsky. "Und so ist alles willkommen, was ihn aus dieser Zwickmühle nimmt."
Lewandowsky forscht dazu, wie sich Falschinformationen verbreiten und was dazu führt, dass Menschen wissenschaftliche Belege akzeptieren oder nicht – auch in Bezug auf den Klimawandel. Vor einigen Jahren zeigte er in einer Studie, dass Menschen möglicherweise auf Verschwörungstheorien zurückgreifen, um das ganze Thema aus ihrem Leben zu verbannen. Fürchteten sich Menschen etwa davor, dass das Senken von CO2-Emissionen die freie Marktwirtschaft untergrabe, stünden sie vor einem Dilemma: Sie müssen Erkenntisse ablehnen, die belastbar und etabliert sind, schreibt Lewandowsky in der Studie. Eine vermeintliche Verschwörung anzunehmen, sei ein gedanklicher Ausweg, damit sie sich nicht damit beschäftigen müssen.
Beate Ratter, Expertin für Klimaanpassung und Professorin für Integrative Geographie an der Universität Hamburg und Abteilungsleiterin am Helmholtz Zentrum Hereon, hat die Wahrnehmung des Klimawandels in Deutschland untersucht. Die letzte Befragung fand 2022, ein Jahr nach der Ahrtal-Katastrophe statt. "Überrascht hat, dass sich bei der Frage nach den schlimmsten Folgen des Klimawandels für die jeweilige Region, dieses einschneidende Ereignis, mit 135 Toten in Deutschland, gar nicht mehr in den Ergebnissen widerspiegelte", sagte Ratter dem #Faktenfuchs. Klimawandelauswirkungen seien regional unterschiedlich spürbar. "Sie bedeuten für jeden was anderes und die Wahrnehmung und folglich auch der Umgang damit hängt von der Topographie und vom Erlebten ab", schrieb Ratter in einer Mail. "Man hätte erwartet, dass im entsprechenden Postleitzahlenbezirk – auf dieser Ebene konnten wir die Befragung auswerten – Überschwemmung als schlimmste Folge des Klimawandels angegeben würden." Das sei aber nicht so gewesen.
"Stellen sie sich mal vor, wenn Ihnen klar wird, dass da 135 Menschen ums Leben gekommen sind, in Deutschland, nicht in Kalifornien oder Australien oder Bangladesch, sondern in Deutschland, im Herzen Europas, wo wir doch technisch so toll ausgestattet sind, das tut weh", sagt Ratter. "Dann kapseln wir so ein Extremereignis ein und schieben es gedanklich weit weg."
2) Wir wollen die kognitive Dissonanz auflösen
Die psychologische Forschung hat diesen Mechanismus längst bestätigt. Wir Menschen haben es lieber, wenn unsere Überzeugungen einander nicht widersprechen. Deshalb neigen wir dazu, Widersprüche aufzulösen und Aussagen zu glauben, die zu unseren Überzeugungen passen.
"Wenn man zum Beispiel eine generell kritische Einstellung gegenüber dem hat, was man von bestimmten Medien oder politischen Gruppierungen erfährt, dann hat das Einfluss auf die Sicht auf Unterthemen wie Klima oder Ernährung", sagt Lars Schwabe, Kognitionspsychologe und Experte für Erinnerung an der Universität Hamburg. Ob man zum Beispiel – auf der übergeordneten Ebene – Vertrauen hat in die Wissenschaft, wirkt sich darauf aus, welche Überzeugungen man in Bezug auf spezifische Themen wie die Erderwärmung hat.
Verschiedene bewusste und unbewusste Einflüsse, die in der Person selbst liegen oder aus dem Umfeld kommen können, tragen zu grundlegenden Überzeugungen bei, so Schwabe: "das Umfeld, in dem ich mich bewege, die Informationen, die ich als Grundtenor bekomme, auch Wünsche- oder auch ob man einen gewissen inneren Widerstand gegen Veränderungen hat und wie man mit Dissonanz umgeht". Das könne dazu führen, dass man trotz belastbarer Belege richtige Hypothesen ablehnt und faktisch falschen folgt. Und unter diesen Einflüssen kann es auch im menschlichen Erinnern oder im Denken zu Verzerrungen kommen.
Ein Mechanismus, über den das laufen kann, ist die "hypothesengeleitete Wahrnehmung", so Schwabe. Man interpretiert die Realität so, dass sie zu den eigenen Überzeugungen passt - man nimmt sie verzerrt wahr und bestätigt so die These, die man zuvor hatte.
Ähnlich wirkt der Confirmation Bias - der sogenannte Bestätigungsfehler, dem wir alle unterliegen können. Wir suchen und wählen die Informationen, die unseren bisherigen Standpunkt bestätigen. Andere, im Widerspruch dazu stehende Informationen werden häufig ignoriert, abgewertet oder vergessen. Auch das kann eine – unbewusste – Denk-Strategie sein, aus einem inneren Dilemma zu kommen, das wir spüren.
"Menschen neigen dazu, Überzeugungen lieber anzunehmen, die ihre vorherigen Überzeugungen bestärken", sagt Lawrence Torcello vom Rochester Institute of Technology dem #Faktenfuchs in einer Mail. Er ist Experte für Pseudoskeptizismus unter Klimawandelleugnern. Eine einmal akzeptierte Falschinformation schaffe deshalb eine Verzerrungs-Spirale, die sich selbst verstärke, so Torcello. Social Media und deren Algorithmen verstärkten diesen Effekt zusätzlich.
Fluchtwege aus der Dissonanz können also in die Irre führen. Die Fakten zu verharmlosen kann etwa wie ein Ausweg erscheinen. "1947 war schlimmer, 2003 war noch schlimmer. Hitze im Juni, oder Juli oder August ist vollkommen normal", schreibt ein User auf X. Solche Sätze seien eine Möglichkeit, kognitive Dissonanz zu beruhigen – eine rhetorische Ausstiegsstrategie, sagt Lewandowsky. Und sie sei einfach. Denn natürlich sei es früher auch mal heiß gewesen. Der Knackpunkt ist, dass es heißer wird und etwa die Zahl der Hitzetage zunimmt.
3) Darstellung von Klimaschutz als Bedrohung
Wenn es um die breite Öffentlichkeit geht, seien die meisten Klimawandelleugner schlicht Opfer von Desinformation, schreibt Torcello dem #Faktenfuchs in einer E-Mail. Die Desinformation wiederum werde bewusst von Politiker oder Aktivisten gestreut. Und im Gegensatz zum normalen Bürger hätten diese eine klare Absicht: nämlich die Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu verzögern.
"Diejenigen, deren politische Ideologie eher in Richtung 'freie Marktwirtschaft' tendieren, sind anfälliger für Desinformation über den Klimawandel", schreibt Lawrence Torcello. Weil Klimaschutz-Maßnahmen politische Regulierung oder auch eigene Verhaltensänderung erfordert, nähmen sie den Klimawandel als Bedrohung wahr für ihre ideologische Einstellung. Diese Wahrnehmung werde aber von einigen Politikern befeuert.
Erdölkonzerne hätten viel Geld in PR-Kampagnen und Lobbyarbeit gesteckt, um politisches Handeln hinauszuschieben, sagt Torcello, der Experte für die Strategien der Klimawandel-Leugner. Zugleich machten sich jene, die die Falschinformation von der angeblichen Klimapanik oder vom vermeintlichen Klimaschwindel verbreiten, zunutze, dass es auch in der Bevölkerung bereits ideologische Voreingenommenheiten gebe. Also bestehende Überzeugungen, die eine sachliche Aufnahme von Fakten verzerren können.
Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, schrieb auf X zum Beispiel: "Ganz normale jahreszeitliche Wetterphänomene werden medial dazu missbraucht, Menschen Angst zu machen und nicht nur die Klimaideologie weiter voranzutreiben, sondern von den echten Sorgen und Nöten der Bürger in unserem Land abzulenken." Sie streut und befeuert also Zweifel an Klimaschutzmaßnahmen. Die Folge: Die Narrative verfangen und Menschen verbreiten sie weiter. Sie reagieren mit Abwehr auf die Erkenntnisse der Klimaforschung, auch sie unterstellen den Mächtigen bewusste Manipulation: "Hitzewelle 1976 - da ging fast nichts mehr. Bitte nicht vergessen. Sie wollen euch im Panikmodus halten. Angst essen Seelen auf!", schreibt ein User auf X.
Es gebe viele politische Kräfte, die sich gegen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels stellen, sagt auch Lewandowsky. Deshalb sei es sehr schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, dass das Problem lösbar ist. "Es gab eine regelrechte Angstkampagne gegen jegliche Maßnahmen gegen den Klimawandel. 'Oh, das wird die Wirtschaft ruinieren. Oh, ihr werdet alle arm sein. Oh, ihr werdet zu Fuß zur Arbeit gehen müssen'", sagt Lewandowsky. Politiker oder Aktivisten, deren Agenda die Maßnahmen-Verhinderung ist, sagten alles, was nötig ist, um das zu erreichen.
Das verfängt, wenn eine grundsätzliche Empfänglichkeit für solche Hypothesen da ist – und eine psychische Entlastung willkommen. "Menschen, die sagen, dass der Klimawandel ein Schwindel sei, sind nicht alle Verschwörungstheoretiker", sagt Lewandowsky. "Aber sie sagen Dinge, die im Grunde genommen eine sehr kurze Verschwörungstheorie sind. Wenn man sie fragt: 'Was meinen Sie damit? Erklären Sie mir, warum es sich beim Klimawandel um eine Falschmeldung handelt.' Nun, das kann man ohne eine Verschwörungstheorie nicht erklären, oder?" Mit der Behauptung vom Schwindel hätten sie etwas, das sie sagen können, um einer unangenehmen Situation zu entkommen. "Nämlich der Tatsache, dass sie sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen."
Sozialwissenschaftliche Forschung zeige, dass Verschwörungstheorien tröstend wirken können auf Menschen, wenn sie einer furchteinflößenden Wirklichkeit begegnen, sagt auch Torcello: Das könne Menschen das Gefühl geben, dass die Bedrohung gar nicht so groß sei und sie sich nicht so sehr sorgen müssten. Oder dass sie nur die vermeintlichen Verschwörer enttarnen müssten – statt die komplexere Herausforderung zu lösen, global fossile Energieträger zu ersetzen.
4) Widerstand gegen Veränderungen
Viele Klimaforscher sind sich einig, dass die Menschheit den Klimawandel eindämmen kann – wenn der Wille dazu da ist. Dafür sind Veränderungen notwendig – über die konkreten Maßnahmen gibt es politischen Streit. Viele aber stemmen sich gegen Maßnahmen, die die Erderwärmung begrenzen könnten. "Was soll denn da alles verändert werden, sollen wir jetzt alle wieder zurück in die Steinzeit", schreibt ein anderer X-Nutzer zum Klimawandel.
Wir Menschen seien veränderungsresistent, sagt Beate Ratter, die Expertin für Klimaanpassung. Deshalb versuche unser Denken, den Klimawandel wegzuschieben: "Zum Beispiel örtlich – dann denke ich, der Klimawandel findet in Bangladesch oder Australien statt, aber nicht hier. Oder zeitlich – der Klimawandel findet irgendwann mal statt, aber nicht jetzt. Oder sozial – der Klimawandel trifft arme Menschen, aber nicht mich. Diese Verzerrungen schützen uns."
Was kann gegen die Verzerrungen helfen?
Wir sind den Verzerrungen und Denkfallen allerdings nicht hilflos ausgeliefert. Wenn wir sie kennen, können wir versuchen, uns sozusagen selbst beim Denken zu beobachten und mögliche Fehler zu erkennen.In der Forschung stellte sich zudem heraus, dass es helfen kann, über bestimmte Formen von Desinformation Bescheid zu wissen und sozusagen vorgewarnt zu sein – auch in Bezug auf den Klimawandel. Das funktioniere wie eine Impfung, sagen Experten wie der Sozialpsychologe Sander van der Linden von der University of Cambridge.
"Scheinargumenten und Logikfehlern schon einmal im Vorhinein ausgesetzt zu werden und zu erfahren, warum sie in die Irre führen", schrieb Lawrence Torcello, "scheint einen 'Impfeffekt' zu haben."
Fazit
Viele spüren eine unangenehme Spannung zwischen unserem Wissen um den Klimawandel und dem persönlichen Wunsch, ihm zu entkommen. Unser Denken sucht sich hieraus Auswege. Ein gedanklicher Fluchtweg kann sein, den Klimawandel und seine Folgen zu verharmlosen. Genau darauf setzen auch politische Kampagnen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel aufzuhalten.
Quellen:
Interviews/Presseanfragen:
Beate Ratter, Expertin für Klimaanpassung und Professorin für Integrative Geographie an der Universität Hamburg und Abteilungsleiterin am Helmholtz Zentrum Hereon
Ralf Ludwig, Professor für Angewandte Physische Geographie und Umweltmodellierung am Geographischen Institut der LMU München
Stephan Lewandowsky, Professor für Kognitionspsychologie an der University of Bristol und derzeit an der Universität Potsdam Leiter des Projekts Protecting the Democratic Information Space in Europe
Lars Schwabe, Kognitionspsyhchologe und Experte für Erinnerung von der Universität Hamburg
Lawrence Torcello, Philosoph und Experte für Pseudoskeptizismus unter Klimawandelleugnern vom Rochester Institute of Technology
Karsten Haustein, Meteorologe und Klimawissenschaftler an der Universität Leipzig
Andreas Becker, Leiter der Abteilung Klimaüberwachung des DWD
Veröffentlichungen
BR24 #Faktenfuchs: Angreifen, ablenken, weglassen: Methoden der Klimawandelleugner
BR24 #Faktenfuchs: Wann ist das Wetter extrem?
BR24: Gefährliche Hitze: Folgen des Klimawandels für die Gesundheit
BR24 #Faktenfuchs: Klimawandel heute - wie Bayern ihn schon spürt
BR24 #Faktenfuchs: So viel CO2 trägt Deutschland zum Klimawandel bei
BR24 #Faktenfuchs: Klimawandel morgen: Die Folgen für meine Region
BR24 #Faktenfuchs: Wie entstehen belastbare Fakten
European Science-Media Hub, Sander van der Linden on how psychological inoculation protects against false news
Klimafakten.de, Klimakommunikation, Kenne Dich selbst – und Deine Schwächen
Lewandowsky, S.: Conspiracist cognition: chaos, convenience, and cause for concern. Journal for Cultural Research
Ratter B, Runge A: Klimawandelwahrnehmung und Extremereignisse in Deutschland, 2022.
Spektrum, hypothesengeleitete Wahrnehmung
Spektrum, Bestätigungstendenz
Tagesschau, “Die Flut hat uns alle total verändert"
Torcello, L. (2016). The ethics of belief, cognition, and climate change pseudoskepticism: Implications for public discourse. Topics in Cognitive Science
The Emergency Docs, Ep. 44: The Science Of Misinformation And How To Prevent It With Dr. Sander van der Linden
Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.
"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!