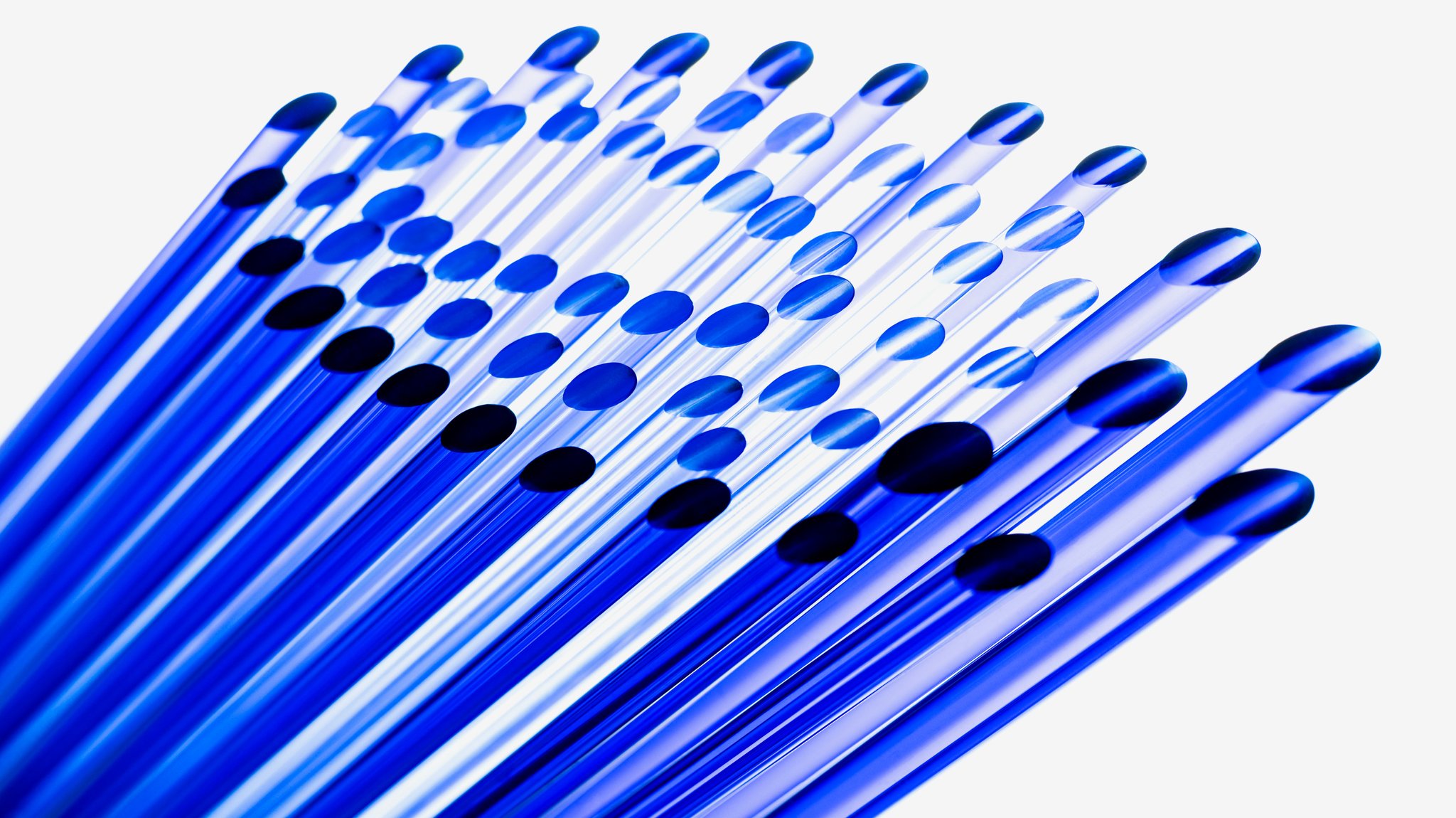Im Deutschen Museum in München wurden die drei für die Endrunde des Deutschen Zukunftspreises nominierten Teams bekanntgegeben. Das sind ihre innovativen Projekte:
Spezielles Lasergerät zur Korrektur von Fehlsichtigkeit
Das von Mark Bischoff, Gregor Stobrawa und Dirk Mühlhoff und ihrem Team der Carl Zeiss Meditec AG entwickelte spezielle Lasergerät schafft es – anders als vorherige Lasergeräte und Verfahren – ohne unnötige Schnitte, Fehlsichtigkeiten zu beheben. Mit ihrer als "SMILE®-Technik" bekannt gewordenen Augenlaser-Methode haben sie die Korrektur von Fehlsichtigkeiten schneller und schonender gemacht.
Ein sogenanntes "Lentikel", ein kleines, linsenförmiges Stück Gewebe in der Hornhaut, könne mit dem leistungsstarken Laser geformt werden, erklärt der Teamsprecher Mark Bischoff den Unterschied zu früheren Verfahren. Das Lentikel werde dann durch eine kleine Öffnung "vom Chirurgen aus der Hornhaut des Patienten beziehungsweise der Patientin extrahiert, und das bewirkt genau die beabsichtigte Sehkorrektur".
Mit dieser für den Zukunftspreis nominierten Innovation ist das Unternehmen ZEISS auf dem Gebiet der Lasersehkorrektur heute Weltmarktführer.
"Natur-Polymere" – von der Natur abbaubarer Kunststoffersatz
Die Idee von traceless materials®, dem zweiten für den Zukunftspreis nominierten Team: Einen Plastikersatz herzustellen, der biologisch abbaubar ist. "Kunststoffe sind aufgebaut in langen Ketten, die die Natur nicht abbauen kann. Deshalb braucht es für die Natur ein neues Material", beschreibt Anne Lamp, eine der Entwicklerinnen, die dafür zu bewältigende Herausforderung.
Dem Team um Anne Lamp, Sina Spingler und Niklas Rambow ist es schließlich gelungen, einen solchen Kunststoffersatz aus Pflanzenresten herzustellen. "Wir haben sie Natur-Polymere getauft. Das ist im Endeffekt das, was die Natur selber produziert. Die Natur kann ihre eigenen Produkte natürlich komplett abbauen", erklärt Anne Lamp ihre Innovation im BR-Interview.
Der Vorteil dieser Kunststoffe: Sie können nicht nur von der Natur abgebaut werden, ohne Spuren zu hinterlassen - daher der Name des Unternehmens (traceless®, englisch: spurlos). Auch die Herstellung des Biokunststoffs ist in den vorhandenen Fertigungsanlagen der Kunststoffindustrie möglich. Und: Das Biogranulat muss nicht ganz so stark erhitzt werden, um für seinen Verwendungszweck verformt werden zu können, wie herkömmlicher Kunststoff. Das spart Energie. Ein Nachteil ist aber: Das Biomaterial von traceless® eignet sich nur für kurzlebige Produkte, wie etwa Eislöffel oder Verpackungen. Kommt es längere Zeit mit Wasser oder Wärme in Berührung, zersetzt sich das Material nach und nach. Schon heute kommt der Biokunststoff zum Einsatz, etwa im Onlinehandel für Verpackungen.
Antriebe aus Wasserstoff für Lkw – elektrisch und emissionsfrei
Einen völlig neuen Antrieb für Lkw im Schwerlastverkehr, der emissionsfrei, leise und wirtschaftlich fährt, hat ein Team der Robert Bosch GmbH gemeinsam mit weiteren Partnern entwickelt. Christoffer Uhr, Kai Weeber und Pierre Andrieu sind dafür als drittes Team für den Zukunftspreis 2025 nominiert.
Das Herzstück dieser Innovation ist ein Brennstoffzellen-System, das aus Wasserstoff Strom erzeugt. Der treibt dann entweder den Elektromotor direkt an oder wird in einem kleinen Akku für Lastspitzen zwischengespeichert. So bleibt der Lkw immer leistungsbereit, egal wie viel Energie er gerade zum Fahren braucht.
Das System habe Vorteile, betont auch Jörn Ebberg, zuständiger Sprecher von Bosch. Die Lkw hätten damit 1.000 Kilometer Reichweite mit einer Tankfüllung, auch im Winter, seien wesentlich leichter als solche mit batteriebetriebenem Antrieb und das Brennstoffzellen-System bestehe aus vergleichsweise wenig kritischen Rohstoffen.
Das Antriebssystem wird bereits in Stuttgart und im chinesischen Chongqing in Serie gefertigt. Weltweit sind schon mehrere tausend Lkw damit auf der Straße. "Wir haben das erste Brennstoffzellen-System entwickelt, das speziell für den Fernverkehr die Anforderungen erfüllt und für das eben auch eine Serienfertigung existiert. Soweit uns bekannt, erfüllt diese Bedingungen bisher keiner", sagt Jörn Ebberg.
Anhören: Diese drei Projekte sind für den Zukunftspreis 2025 nominiert
Der Deutsche Zukunftspreis - so sieht die Trophäe aus.
Deutscher Zukunftspreis 2025 wird am 19. November verliehen
Der Deutsche Zukunftspreis wird seit 1997 verliehen und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Schon die Nominierung gilt als hohe Auszeichnung. Das vorgestellte Produkt muss nicht nur innovativ, sondern bis zur Marktfähigkeit entwickelt sein und sich durch eine hohe praktische Anwendung und ein breites Potenzial in Industrie und Gesellschaft auszeichnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den mit 250.000 Euro dotierten Preis am 19. November 2025 in Berlin.
Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.
"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!